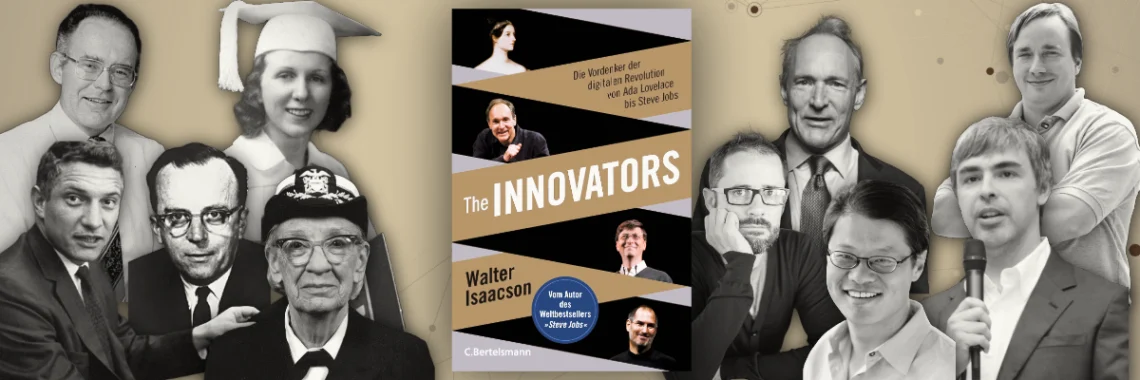
Von Ada Lovelace bis Steve Jobs: Warum echte Innovation immer Teamarbeit erfordert – Lektionen aus Isaacsons Werk
Was haben Batman, Severus Snape und Tony Stark gemeinsam? Sie alle verkörpern den Archetyp des „Byronschen Helden“ – rebellisch, ambivalent, einsam in seiner Genialität. Dieses Motiv gehört zu den bedeutenden Vermächtnissen von Lord Byron und zu unserer Vorstellung davon, dass Innovationen von einsamen Ausnahmetalenten in ihren stillen Kämmerlein entstehen.
Doch Lord Byrons eigene reale – nicht von ihm inszenierte – Biographie widerlegt dieses Narrativ. Denn Lord Byron hinterliess der Welt nicht nur unzählige romantische Werke, sondern auch eine Tochter: Augusta Ada King-Noel, besser bekannt als Ada Lovelace, die erste Software-Entwicklerin der Geschichte.
Mit ihr startet der renommierte Biograf Walter Isaacson das Buch “The Innovators: Die Vordenker der digitalen Revolution von Ada Lovelace bis Steve Jobs”.
Das zentrale Thema:
Wirklich bahnbrechende Innovationen entstehen nicht im Alleingang, sondern in der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Personen, Gruppen und Generationen.
Das Märchen vom einsamen Genie
Einer der größten Mythen der Innovationsgeschichte ist die Vorstellung von isolierten Erfindern, die einen unglaublichen Eureka-Moment erleben und sofort die Welt verändern können. Dieses Narrativ entstand womöglich in der Literatur zu Unterhaltungszwecken. Es wird nach wie vor aufrechterhalten und taucht in Filmen und Serien unseres post-heroischen Zeitalters.
Walter Isaacson zeigt, dass unsere digitale Realität keine Folge von Handlungen einzelner Erfinder ist:
- Steve Jobs Vision von “1,000 songs in your pocket” würde ohne Steve Wozniak und ein Team aus Designern und Ingenieuren eine Vision bleiben und uns später kein iPhone bescheren.
- Ohne Ingenieure und Praktiker würde die Theorien von Alan Turing nur Theorien bleiben und nicht in funktionierenden Maschinen münden.
- Und ohne die Analytical Engine von Charles Babbage hätte Ada Lovelace nie erkannt, dass Maschinen mehr können als nur rechnen – sie könnten programmierbar sein.
Allein diese Beispiele widerlegen die Macht des Individualismus und zeigen die Kraft der Gruppe und der Zusammenarbeit.
Die Alchemie erfolgreicher Teams
Ja, Innovation braucht ein Team, aber nicht irgendein Team: erfolgreiche Teams kombinieren unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken jedes einzelnen. Visionäre liefern große Ideen, pragmatische Führungskräfte sorgen für deren Umsetzung. Walter Isaacson schreibt treffend in seinem Buch:
“Visionen ohne Umsetzung sind Halluzinationen.”
Erstaunlicherweise gehörte zum Team um Ada Lovelace auch ihr Ehemann, der sie tatkräftig unterstützte, indem er ihren Code mit der Tinte sauber abschrieb. Lady Lovelace fehlte die Geduld für diese mühsame Abschreibarbeit.
Robert Noyce und Gordon Moore (bekannt besonders durch das Moore’sche Gesetz, das besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip etwa alle zwei Jahre verdoppelt, was eine exponentielle Steigerung der Rechenleistung ermöglicht), zwei brillante Köpfe, beschäftigten sich mit der Entwicklung von Mikrochip- und Halbleitertechnologie. Sie waren Mitbegründer von Intel und spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung eines modernen Computers. Was sie aber nicht konnten: Entscheidungen treffen, Prozesse organisieren, Strukturen aufsetzen, Ziele definieren. Kurzum konnten sie kein Unternehmen führen. Diese Rolle übernahm Andy Grove, der seit vielen Jahren für seine innovativen Führungsfähigkeiten gefeiert wird. Seine Bücher “High Output Management” und “Only the Paranoid Survive: How to Exploit the Crisis Points That Challenge Every Company” gehören zu den Must-Reads für jeden Manager.
Gerade in der aktuellen KI-Revolution sehen wir: Innovation ist ein Teamsport. OpenAI hat nicht nur Genies wie Ilya Sutskever, sondern auch Geschäftsleute wie Sam Altman und ein starkes Netzwerk aus Investoren.
Die Quellen der Innovation
Im digitalen Zeitalter gibt es drei bewährte Modelle, um Innovation voranzutreiben:
- Durch die staatliche Förderung: Große technologische Durchbrüche – vom Internet bis zum GPS – entstanden oft durch öffentliche Finanzierung. In extremen Situationen, wie z.B. im Krieg oder bei der Finanzierung von Raumfahrtprogrammen (z. B. SpaceX und Starlink), kann der Staat eher Mittel mobilisieren und diese für akademische und militärische Forschung bereitstellen.
- Durch private Unternehmen: Firmen wie Bell Labs, Xerox PARC, Google investieren massiv in Innovation – getrieben vom Wettbewerbsdrang (Nokia und Kodak sind die Namen, die den Bedarf dafür sehr gut erklären) und von Investoreninteressen. Dank der Kultur der Investorenkapitals, die sich in den USA Mitte des 20ten Jahrhunderts etabliert hat, ist die USA meilenweit Europa in Sachen Innovation voraus. Ein Buchtipp dazu: Ilya Strebulaev und Alex Dang beschäftigen sich mit dem Erkunden der Rolle des privaten Kapitals in der Innovation in ihrem Buch “The Venture Mindset: How to Make Smarter Bets and Achieve Extraordinary Growth”.
- Durch Open-Source-Kollaboration: das besondere an der digitalen Revolution, dass viele Innovationen durch eine freiwillige Community entstanden sind, die Wissen frei teilte. Schon in den 1960ern zeigte sich die Kraft von Open Source: ‘Spacewar!’ entstand durch eine Community von Programmierern, die ihr Wissen teilten – ein Prinzip, das bis heute Innovationen wie Linux oder ChatGPT antreibt. Die Konkurrenz zwischen Open-Source und proprietären Produkten sorgt ebenfalls für weitere Fortschritte.
Durch die Lockerung der Schuldenbremse wird für Deutschland im Jahr 2025 ein Konjunkturhoch, also ein Boom in der wirtschaftlichen Entwicklung erwartet, das insbesondere Innovationen in forschungsintensiven Bereichen vorantreiben soll.
Der Zauberstab der guten Führung
Ada Lovelace war nicht darauf angewiesen, die anderen von ihrer Arbeit zu überzeugen. Charles Babbage musste das allerdings machen, um die nötigen Gelder für seine Maschine zu erhalten. Und offensichtlich würde dafür eine sachliche Planvorstellung nicht ausreichen. Innovationen müssen bezaubern. Innovatoren müssen die anderen überzeugen.
“Charisma zu haben”, hübsch, eloquent und nett zu allen zu sein, reicht es für eine gute Führung nicht. (In Deutschland trifft man in den Führungsetagen auch überproportional häufig auf Menschen mit “noblen” Nachnamen: einem Herrn Kaiser wird mehr zugetraut, als einer Frau Müller – Link.)
Bill Gates und Steve Jobs galten als schwierige Persönlichkeiten – doch sie wussten, wie man starke und loyale Teams aufbaut. Robert Noyce und Gordon Moore konnten zwar schlecht unternehmerisch handeln, aber sie hatten eine Vision, konnten strategisch denken und förderten eine nicht-hierarchische, offene Unternehmenskultur. Zusammen mit Andy Grove etablierten sie eine ikonische Innovationskultur in Silicon Valley, die Google, Meta und andere Firmen unserer Zeit zum Vorbild genommen haben. Sergey Brin und Larry Page gaben ihren Ingenieuren notwendige Autonomie, die innovative Produkte wie Google Mail und Google Maps herausbrachten.
Die magischen Formeln des Produkts
Ada Lovelace setzte die Messlatte hoch: Sie konnte sich weder zwischen ihren poetischen noch zwischen ihren technischen Interessen entscheiden und beschäftigte sich intensiv sowohl mit Mathematik als auch mit Literatur. Und genau das macht erfolgreiche Innovatoren aus. Sie befinden sich an der Grenze verschiedener Welten:
- sie verstehen Technologie und Design,
- sie können humanitäre und naturwissenschaftliche Aspekte in ihrer Arbeit verlinken.
Und sie denken in erster Linie aus der Produktperspektive. Larry Page definierte so:
“The best leaders are those with the deepest understanding of the engineering and product design.”
Steve Jobs brachte es auf den Punkt:
“When the sales guys run the company, the product guys don’t matter so much, and a lot of them just turn off.”
Als Apple Computers in den 80er Jahren von einem Ex-“Pepsi”-Marketing-Chef, John Sculley geleitet wurde, fuhr das Unternehmen wörtlich fast in die Ruin. Die magische Formel des “Pepsi-Erfolgs” passt offensichtlich nicht auf die Apple-Produkte. Das wurde zur zweiten Chance von Steve Jobs selbst und läutete die neue Ära in der Geschichte des Unternehmens.
Aber selbst das bahnbrechendste Produkt bringt nichts, wenn es keine Aufmerksamkeit bekommt: Innovationen müssen sichtbar gemacht werden.
Douglas Engelbart, ein Ingenieur am Stanford Research Institute, erkannte in den 60ern den Bedarf, Innovation bekannt zu machen. 1968 organisierte er mit seinem Team die erste Produktdemo “The mother of all demos”. Damals stellte er eine Vielzahl revolutionärer Technologien vor, darunter auch die erste Computermaus. Die Produktinszenierungen von Apple, Google, Meta sorgen dafür, dass alle Neuerungen von Anfang an große Beachtung bekommen.
Auf der Suche nach dem Stein der Weisen
Die Alchemisten experimentieren seit dem Anbeginn der Zeit, um den Stein der Weisen zu erschaffen. Manche haben immer noch nicht aufgegeben. Dieser Mut, was Neues zu probieren, ist essentiell für die Innovation:
- Das wievielte iPhone ist gerade auf dem Markt? Viele der größten Erfindungen waren in ihrer ersten Version fehlerhaft oder unvollständig. Das erste iPhone hatte keinen App-Store, die Probleme mit dem Mikrophone sorgten für ordentlichen Spott an Apple.
- Der erste Personal Computer war ein Kasten ohne Tastatur und Monitor und war viel zu teuer für ein Massenprodukt. Der erste Mac war alles andere als das elegante MacBook Pro, auf welchem ich diese Zeilen schreibe.
- Die Idee des Internets, die Vannevar Busch Mitte des 20. Jahrhunderts gesetzt hat, brauchte Jahrzehnte und mehrere Zwischenstationen (ARPANET, USENET, BITNET), bis sie die aktuelle Form annahm.
Doch entscheidend war, dass diese Ideen in die Welt gesetzt und iterativ verbessert wurden. Und ja, manche Unternehmen lassen sich diese Neuheiten ordentlich bezahlen.
Bent Flyvbjerg erkennt in seinem Buch “How Big Things Get Done”, dass große Projekte oft daran scheitern, dass sie auf Perfektion abzielen, anstatt früh zu starten und sich flexibel weiterzuentwickeln. Innovation entsteht nicht durch Perfektionismus, sondern durch den Mut weiter zu experimentieren.
Vor ein paar Jahren fasste Evan Williams, Mitgründer von Twitter, in seinem Streit mit einem anderen Co-Founder Jack Dorsey wie folgt zusammen:
“People don’t invent things on the Internet. They simply expand on an idea that already exists.”
Und das beschreibt sehr gut einen Innovationsprozess: immer iterieren, immer aufbauen.
Es geht um die richtige Stunde
Manche Innovationen sind ihrer Zeit voraus:
“Elektroautos werden (…) jeden ansprechen, der ein absolut geräuschloses, geruchloses, sauberes und stillvolles Gefährt such, das einen nie im Stich lässt”, lautet ein Werbetext aus … 1903.“
(Zitiert aus dem Buch “Die Mutter der Erfindung” von Katrine Kielos-Marçal).
Hätte sich das Elektroauto vor über einem Jahrhundert durchgesetzt, hätten wie heute eine ganz andere Welt vor uns. Der Siegeszug von Elektroautos findet jetzt angesichts einer Klimakatastrophe statt und hat sich im Wesentlichen einem “Macho-haften” Innovator zu verdanken.
Der Begriff “artificial intelligence” wurde bereits in den sechziger Jahren vom Professor John McCarthy geprägt. Alan Turing und auch Ada Lovelace stellten sich die Frage, ob eine Maschine denken könnte. In den Genuss, die künstliche Intelligenz “in action” zu erleben kamen die meisten erst Ende 2023, als ChatGPT, das Produkt des Unternehmens OpenAI, an den Start ging. Erst vor weniger Zeit stimmten alle Konditionen, um dieses Produkt und viele weitere AI-Produkte, erfolgreich launchen zu können.
Das sind nur zwei aus vielen anderen Beispielen, dass jede Innovation ihren richtigen Zeitpunkt braucht, um einen breiten Zugang und (kommerziellen) Erfolg zu bekommen.
Der Grundstein zukünftiger Innovationen
Haben also Batman, Severus Snape, Tony Stark und Hunderte andere einsame Genies aus der eher westlichen Kulturerbe etwas mit der Realität gemeinsam? Ja. Es gibt immer wieder Ausnahmetalente, die bahnbrechende Innovationen in ihrem stillen Kämmerlein herausbringen, die aber höchstwahrscheinlich in diesem stillen Kämmerlein verkümmern werden. Die Zukunft gehört den mutigen Teams, die bereit sind, Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gehen. Denn, wie Isaacson zeigt, die größten Ideen entstehen nicht im Vakuum, sondern im lebendigen Austausch und im gemeinsamen Streben nach Fortschritt.
Unser digitales Zeitalter mag uns revolutionär erscheinen, aber es basiert auf Ideen, die uns Generationen davor überliefert haben. Die besten Innovatoren waren diejenigen, die den Verlauf des technologischen Wandels und die Ideen ihrer Vorgänger verstanden haben. Von diesem Menschen können wir lernen, dass wir unsere Zukunft gestalten können, indem wir Zusammenarbeit, offenes Denken und den Mut zum Risiko in unserem Leben verankern.
Walter Isaacsons „Die Innovatoren“ ist mehr als eine Chronik der digitalen Revolution. Es ist eine Hommage an die menschliche Kreativität und den unerschütterlichen Glauben daran, dass wir gemeinsam Großes erreichen können.
Alle Bücher in diesem Artikel
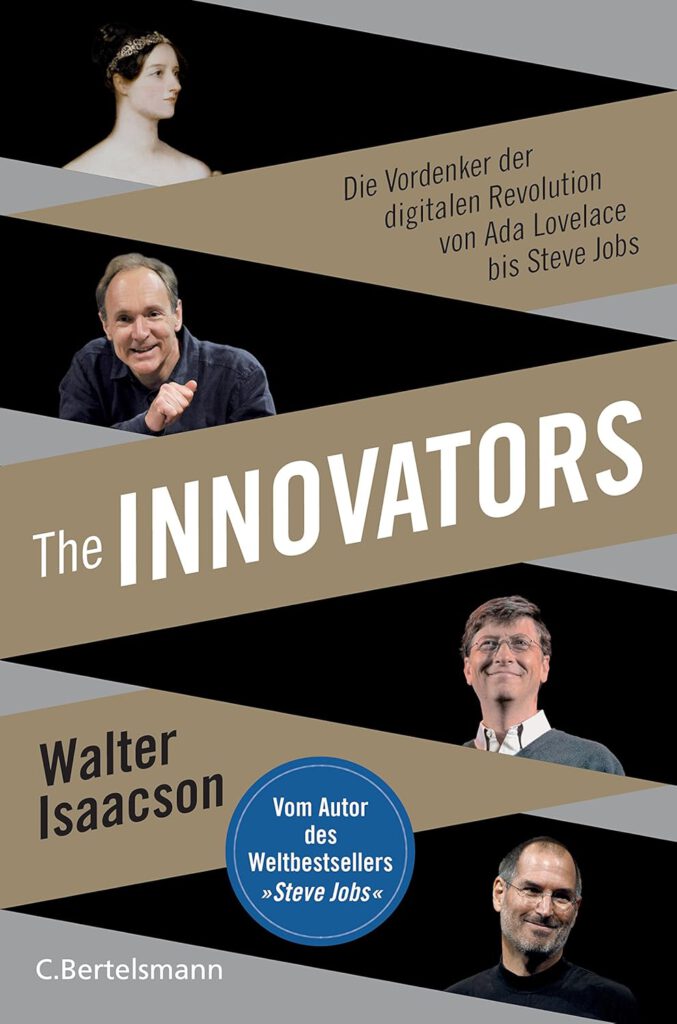
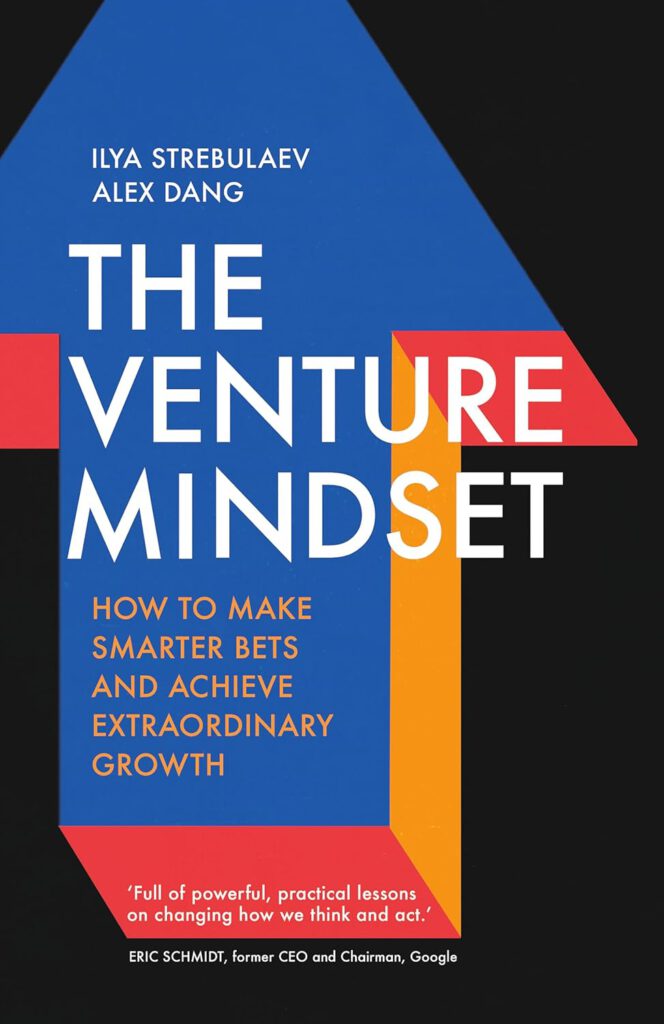
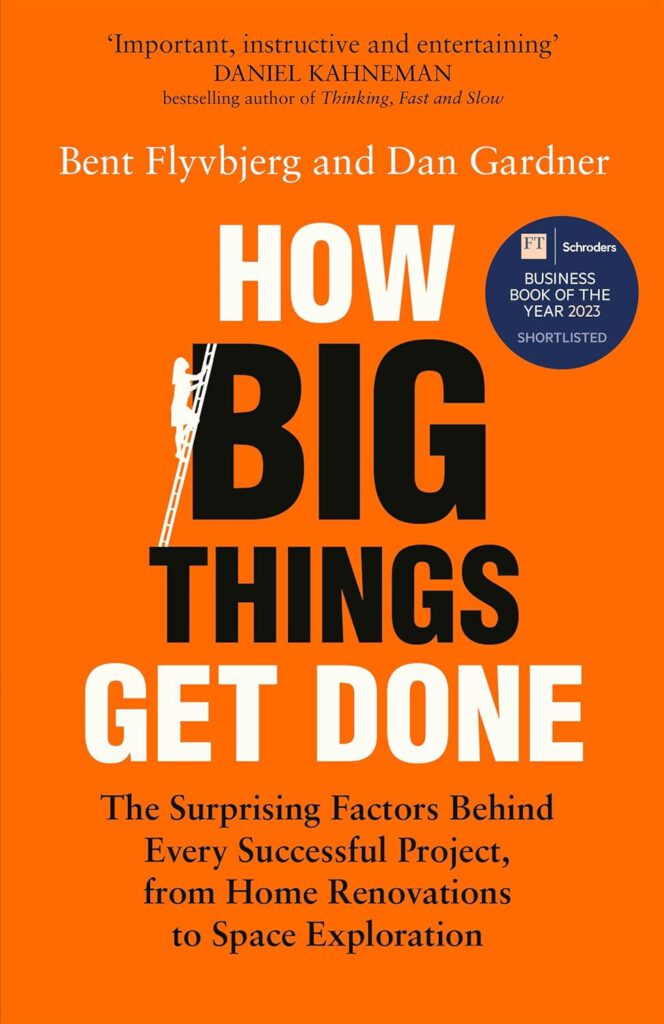
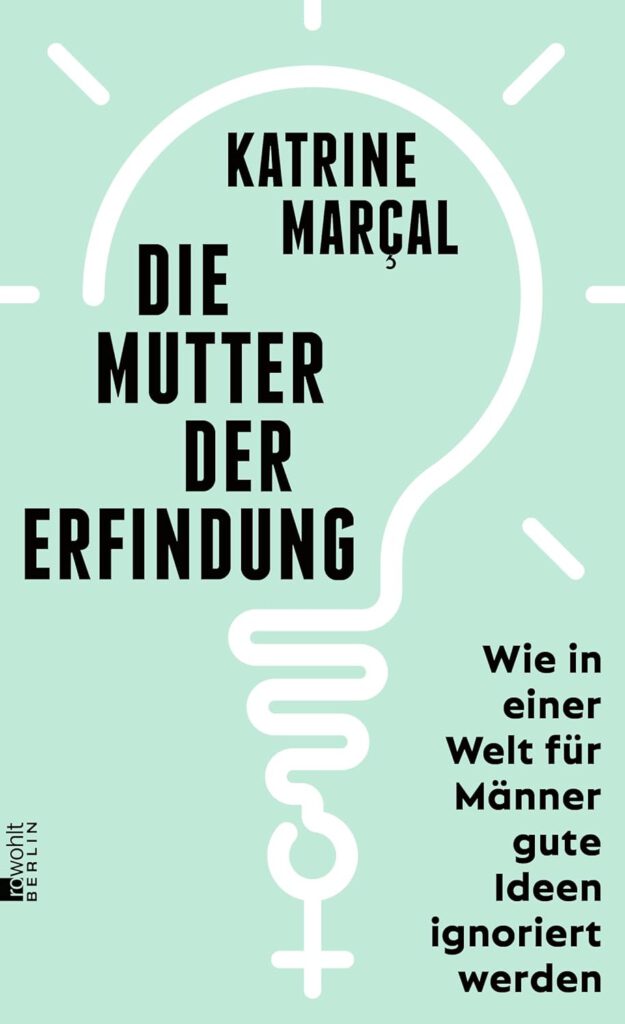
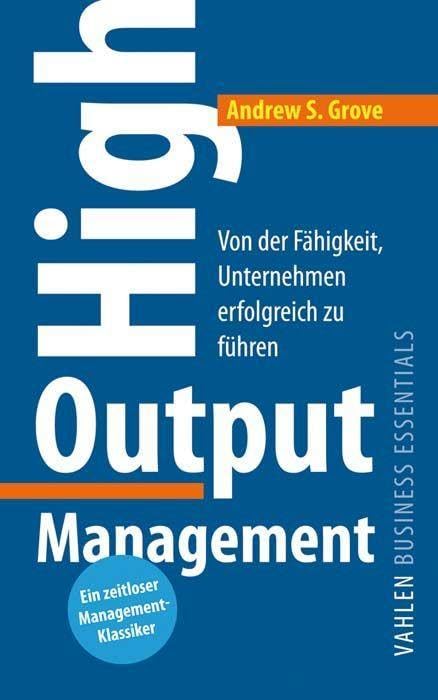
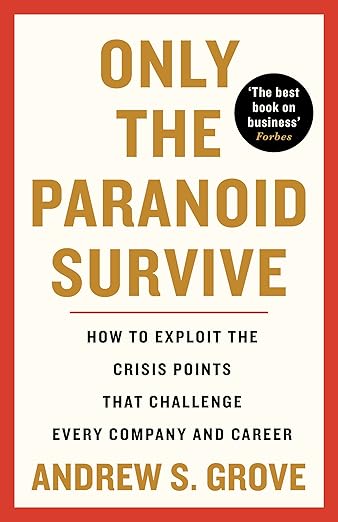



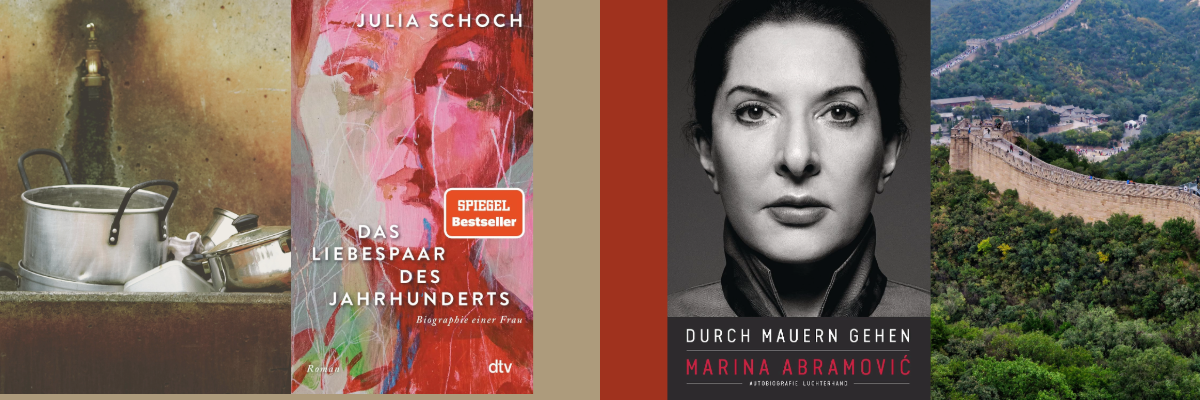
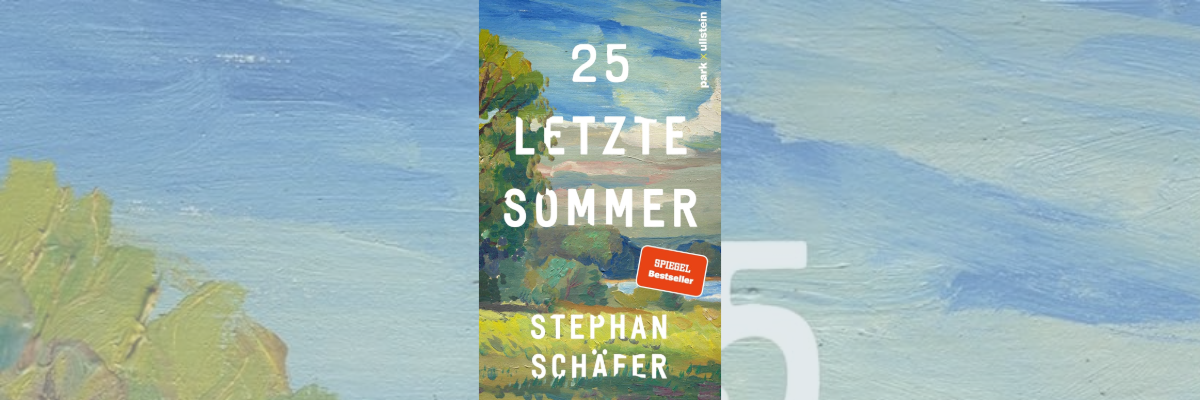
3 Kommentare
Pingback:
Pingback:
Pingback: