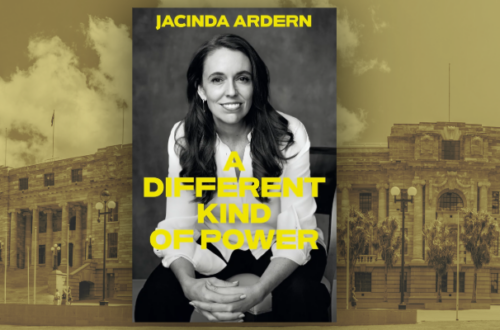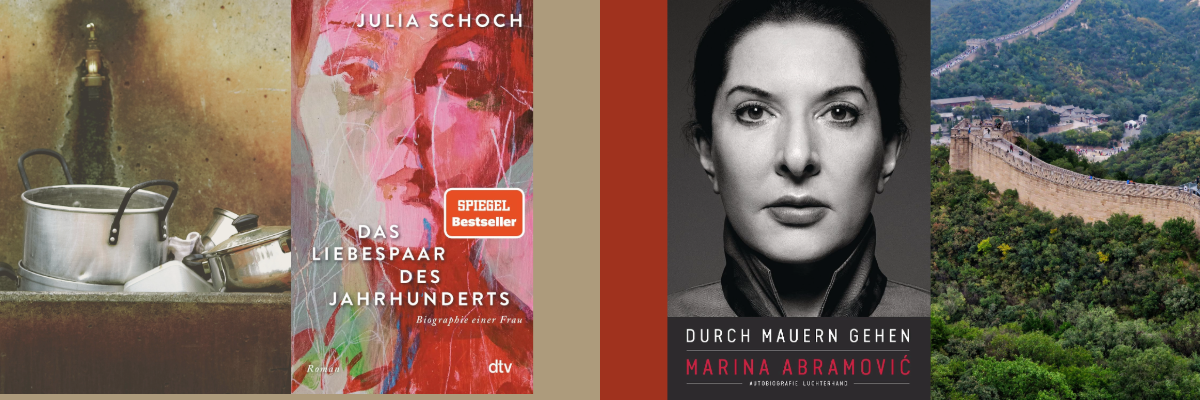Das mangelnde Licht
In den frühen 90ern mangelte es in Georgien an Licht und Wärme. Kerzen, Kerosinlampen, Stromgeneratoren und Kanonenöfen sind in die Wohnungen tausender Leute eingezogen. Gekocht wurde auf dem Lagerfeuer vor einem Plattenbau. Geheizt wurde mit dem Holz aus einem naheliegenden Park. Gelebt wurde von der Hand in den Mund und von der Hoffnung über das bessere Leben.
Unter diesen Bedingungen, die uns im gemütlichen Deutschland des 21. Jahrhunderts fast den Höhlenzeiten gleich vorkommen könnten, lässt Nino Haratischwili ihre Heldinnen Qeto, Dina, Nene und Ira im Roman „Das mangelnde Licht“ aufwachsen. Für ihre anderen Bücher wird die Autorin als Vertreterin des magischen Realismus gefeiert. In der Aufführung des „mangelnden Lichts“ am Hamburger Thalia-Theater erlebte ich viel Realismus und wenig Magie.
Dadurch, dass meine Familie einen sehr engen Bezug zu allem hatte, was damals in Tbilissi, der Hauptstadt Georgiens, passiert war, verflochten die Erzählungen meiner Eltern mit Fernsehbildern. Und zusammen mit meinen damaligen Emotionen, Erlebnissen und Phantasien wurden sie zu meinen Erinnerungen.
Zum ersten Mal erscheinen die vier Freundinnen als quirlige, naturverbundene Freigeister: bereit für Spaß und jedes Abenteuer. Danach sehen wir drei der vier Freundinnen in einem typischen weiblichen Rollenfach: schick gekleidet stolzieren sie durch die Gänge einer Galerie mitten im Herzen des alten Europa mit einem Glas in der Hand. Das suggeriert fast, dass sie es in ihrem Leben geschafft haben, und einen ruhigen Hafen mit einer perfekten Familie, einem perfekten Mann und einem perfekten Job erreicht haben. Nun muss eine Geschichte kommen, wie sie auf einem geraden Weg, all das ohne viel Mühe erreicht haben. Aber Nino schickt jede auf ihre eigene Heldinreise und erlaubt jeder von ihnen unterschiedlich weit die Grenzen davon zu strapazieren, was einer Frau durch die Gesellschaft erlaubt wird.
Die romantische Nene übernimmt die klassischen Rollen einer Frau, die wir aus der Literatur, aus dem Kino und sogar aus der Malerei kennen. Sie ist eine gehorsame Tochter und kann ihrer Familie nicht widersprechen. Ihren Willen hängt sie nach dem Schulabschluss an den Nagel und wird in den Innenwänden eines Hauses eingesperrt. Sie muss sich den Erwartungen der Gesellschaft fügen. In der Aufführung erleben wir sie als eine puppenhafte Braut und als eine Mutter. Sie ist auch ein erniedrigtes Opfer der häuslichen Gewalt. Für ihren laschen Liebhaber (natürlich ihrer GROßEN Liebe) wäre sie aber bereit, das Perverseste über sich ergehen zu lassen. Letztendlich wird sie zu einer Witwe und muss unter Druck ihrer Familie erneut auf eine ähnliche Reise gehen.
Die sensible und ängstliche Qeto genießt die Unterstützung ihrer großen Familie und darf ihr Leben so gestalten, wie sie möchte. Die Welt steht ihr offen: sie darf ihren Beruf selbst bestimmen, muss aber nicht die größte Herausforderung annehmen, sie findet einen Mann, die mit ihr eine Beziehung auf der Augenhöhe führen möchte. Aber all das braucht sie ohne ihre Familie nicht. Sobald sie vor einer Herausforderung der Außenwelt gestellt wird, flieht sie zu ihrer Familie, zu ihrem (genau so wie sie) sensiblen Papa, ihren hochintelligenten Babuljas (Groß- und Urgroßmüttern) und ihrem ängstlichen großen Bruder. Für sie wäre Qeto für alles bereit. Nino spricht ihr aber den Mut ab: bei einer nächtlichen Begegnung mit Banditen, die gerade dabei sind, ihre Schuldner hinzurichten, will sie vorbeigehen, obwohl sie die Möglichkeit hätte, ihnen zu helfen.
Ira wird bereits mehr zugetraut: sie darf üblichen Frauen-Klischess entkommen und muss weder heiraten noch andere Bedürfnisse ihrer Familie befriedigen. Sie darf sogar ihre häusliche Umgebung und ihre Stadt verlassen und sich auf eine Abenteuerreise nach Amerika begeben, was für eine junge Frau aus dem „Osten“ Anfang-Mitte der 90er Jahre definitiv abenteuerlich sein mochte. Sie darf sogar anders sein und Frauen lieben. Sie darf auch gegen mächtige Männer aufstehen und sie mit ihrer formalen Macht als Staatsanwältin besiegen. Aber dafür darf sie Hass und Missverständnis ihrer Nächsten ernten.
Dina geht am weitesten: sie darf diese Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Sie ist in Besitz einer Kamera, die allerdings ihr von einem Mann ausgehändigt wurde, und sie darf ihre eigenen Geschichten erzählen. Sie darf tapfer sein und Zivilcourage zeigen. Sie darf andere beschützen. Sie darf Männer mit einer Waffe angreifen. Sie darf sogar als Photographin die Entbehrungen eines Krieges dokumentieren (ein sehr männlicher Auftrag!). Und sie darf ihr Leben zu etwas Größerem bringen und wird als eine Heldin auch von der Gesellschaft anerkannt und gefeiert. Post mortem.
In einem anderen Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“ wird eine andere Heldin Kitty auch in den Wahn getrieben und von der Autorin ermordet, weil sie die Trennung von ihrem Zuhause nicht mehr aushalten konnte. Ihr männlicher Mitstreiter, ebenfalls getrennt von der Heimat und einem schwerem Last auf der Seele und auf dem Gewissen, durfte aber eines natürlichen Todes im hohen Alter sterben. Ebenfalls hier sehen wir die Annahme, dass eine Frau außerhalb ihrer Umgebung nicht lebensfähig ist.
Nino Haratischwilli schickt die beiden Protagonistinnen, Dina und Kitty, auf eine klassische Heldenreise, bei welcher sie nach ihrem eigenen Ich in einem Zusammenstoß mit der Außenwelt suchen sollten. Ein klassisches, aber untypisches Motiv für einen weiblichen Literaturcharakter. Allerdings bestraft sie auch beide mit dem Tod, da diese sich offensichtlich getraut haben, den Weg zu gehen, auf welchem eine Frau nach Abertausenden Jahren des Patriarchats gar nicht erwartet werden kann.
Diese Dokumentation lässt wahrlich die Atmosphäre jener Tage in Tbilissi verspüren.