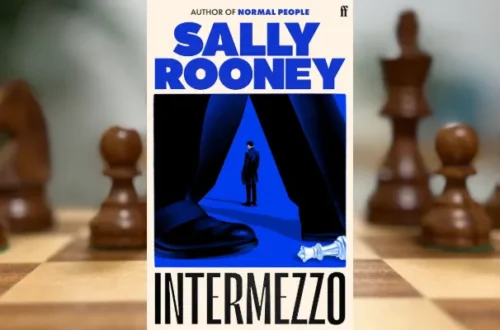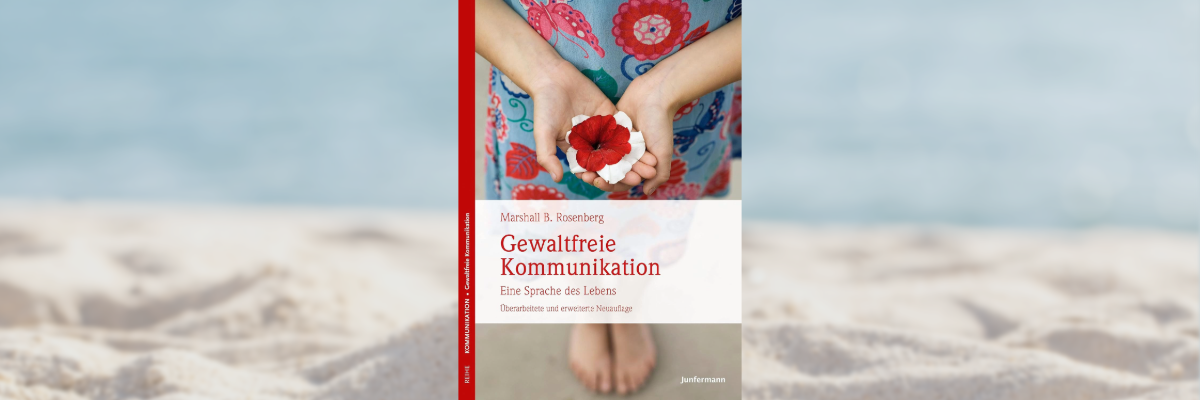Der Matthäus-Effekt
Zum Ende des Jahres habe ich einen kritischen Blick auf die Liste meiner gelesenen Bücher letzter Jahre geworfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Anteil von Bücher, die von Autorinnen stammten, bei weniger als 20% lag. Bis jetzt habe ich bei der Planung meiner „Bibliothek ungelesener Bücher“ (ok, es ist ein Regal und allein aus den Umweltschutzgedanken wird es nie die Ausmaße der Ecos Antibibliothek erreichen) keinen Wert auf die Geschlechterverteilung gelegt. Und dennoch hat mich das aktuelle Verhältnis sehr gewundert, sodass ich reflektieren musste, wie ich meine Leselisten zusammenstelle. Sobald ich feststelle, dass ich bestimmte Wissenslücken schließen muss (z.B. aus beruflichen Gründen) oder will (um die erneuten Eskapaden der Weltherrscher nachvollziehen zu können), geht die Suche los.
Dabei orientiere ich mich auf Empfehlungen, Verweise und Quellen in den bereits gelesenen Büchern und Artikeln von den Branchen-Experten oder Top-Voices, wie sie seit einigen Jahren auf Social Media genannt werden. Häufig verwende ich die TopX-Suchstrategie, bei welcher ich nach einer geordneten und möglichst bewerteten Listen suche wie „Top 10 Bücher, die jeder XYZ 2022 gelesen haben muss“ .Bei diesen Suchstrategien stößt man aber schnell auf Cluster, in welchen immer wieder die gleichen Namen vorkommen. Manchmal sind das auch Bücher von einer sehr mäßigen Qualität und Werthaltung. Und dennoch gelangen häufiger auf unsere Leselisten (und somit auch in unsere Warenkörbe bei Online- oder Offline-Händlern) und werden häufiger von uns auf Social Media in unseren Beiträgen angepriesen und zitiert.
In der Soziologie wird dieses Phänomen als „kumulativer Vorteil“ bezeichnet. Seine Grundlage basiert auf der Idee vom Wissenschaftssoziologen Robert K. Merton, der auch als „Matthäus-Effekt“ bekannt ist. Und ja, es geht hier um ein Zitat von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium:
„Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.“
(Matthäus 25,29; Nach der Übersetzung Martin Luthers)
Merton befasste sich mit der Zitierhäufigkeit von wissenschaftlichen Aufsätzen und kam zum Schluss, dass bekannte Autoren häufiger zitiert werden und dadurch noch bekannter werden. Der amerikanische Volkswissenschaftler Sherwin Rosen befasste sich damit in den 80ern in seinem Essay „Die Ökonomie von Superstarts“. Die Vorteile von „Besseren“ begründete er mit deren besseren Fertigkeiten.
Nassim Taleb bezeichnet dieses Phänomen in seinem „Schwarzen Schwan“ auch als „Effekt der Reputation“ und erkennt, dass alleine die besseren Skills nicht zu kumulativen Vorteilen führen würden, sondern dass auch das pure Glück benötigt wird. Ich finde auch Talebs Idee, dass jede sprachliche Entwicklung das Ergebnis des Matthäus-Effekts sei, sehr interessant.
Wenn ich jetzt die Erklärungen von Rosen und Taleb zum Matthäus-Effekt auf meine Leseliste anwende, würde das bedeuten, dass männliche Autoren deutlich bessere Fertigkeiten und häufiger Glück als weibliche Autoren haben sollten. Die erste Erklärung kann nicht ernst in Betracht gezogen werden. Das letztere wäre alleine nach der Theorie der Wahrscheinlichkeit schlicht unmöglich.
Es sollte also eine weitere Erklärung geben, die den kumulativen Vorteil männlicher Autoren bestärkt…